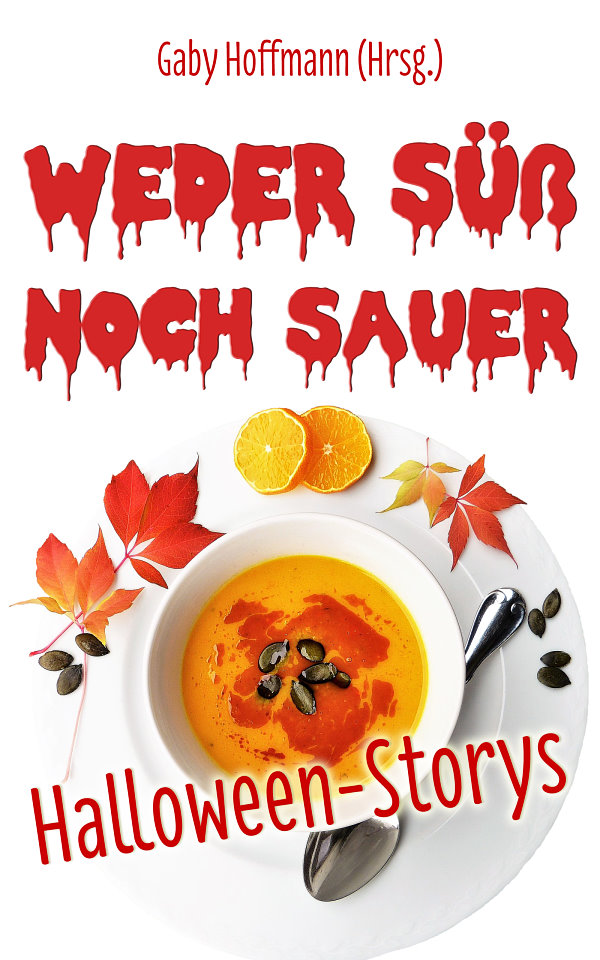Geld vermehrte sich nur dann von selbst, wenn es vorhanden war. Ansonsten wollte es gesucht und gefunden werden.
Diesem Zwang fühlten auch wir uns ausgeliefert. Wir lebten sorglos, doch mit vorausberechenbarem Liquiditätsende.
Das Haus bei Baden-Baden ließ mich nicht zur Ruhe kommen, blieb ein Thema. Instinkt, Gier und Langeweile gaukelten Illusionen vor, und wenn ich nicht gerade daran dachte, so brachte Rolf die Villa zur Sprache. Allein die Vorstellung, andere könnten uns diesen Job wegschnappen, versetzte uns in Unruhe. So war es lediglich eine Frage der Zeit und der Gelegenheit, gemeinsam aufzubrechen.
Schon zwei Tage lang beobachten wir das Haus. Tagsüber, nachts, wir ließen es keine Minute aus den Augen. Wir schliefen im Auto, rasierten uns im Auto oder an einem Bach in der Nähe, und wir verpflegten uns im Auto. Alle zwölf Stunden veränderten wir den Mercedes, inzwischen wieder von vorne bis hinten schwarz. Am Abend klebten wir Reklame für ein Elektrogeschäft drauf, morgens für eine Versicherung, und bald würden wir das Auto wechseln, eines klauen müssen. In dieser noblen Gegend fiel jede Kleinigkeit auf, die nicht hier hingehörte. Alle vorhandenen Nummernschilder hatten wir bereits verbraucht.
Stolz und irgendwie höhnisch stand das Haus auf dem Hügel, von Rasen umsäumt, eingezäunt mit Draht. Verlag Hauser, so stand es im Telefonbuch. Drei Menschen bewohnten die Villa, und zwei Bedienstete hatten eine kleine Dependance außerhalb des Zauns. Die große Frage lautete: Wann endlich würden zumindest die drei für mindestens eine, besser für zwei Stunden das Haus verlassen?
Wieder wurde es abends. Mit dem Tauchsieder kochte ich Kaffee und Dosensuppe.
Resigniert steckte Rolf das Fernglas weg. „Oben geht Licht an. Ich fürchte, auch heute gibt’s keine Chance.“
Dabei hatten wir uns extrem gut vorbereitet. Rolf hatte alles besorgt, was man brauchte, um herkömmliche oder drahtlose Alarmanlagen auszuloten und stillzulegen. Sein Eigenbau war auf dem neusten Stand, mit Computersimulationen geprüft und getestet.
„Wie lange können wir diese Warterei noch riskieren?“, fragte ich.
„Diese Nacht, vielleicht noch eine, länger auf keinen Fall“
„Und wenn wir kein Glück haben?“
„Dann suchen wir uns ganz schnell was anderes. Ich muss dir was sagen.“
Ich ahnte es schon. „Du willst endgültig aussteigen, stimmt’s?“
Er nickte. „Weißt du, so, wie die Dinge im Moment stehen – eine bessere Chance kriege ich nie wieder. Ich mag Marina, auf so etwas habe ich immer gewartet! Wie oft hast du während der Knastzeit von einer Frau geträumt? Ich fast jede Nacht! Und Marina gleicht meiner Traumfrau aufs Haar! Jetzt habe ich sie, dazu eine Bleibe, sogar ein Zuhause, eigentlich alles, was ich brauche und möchte. Ich suche mir einen stinknormalen Job, gehe auf Arbeit, verdiene Geld wie alle anderen. So leicht wie jetzt wird es nie wieder sein. Und ob du es glaubst oder nicht – wenn du ein Zuhause hast, einen festen Tagesablauf, dann kommst du mit viel, viel weniger Geld aus.“
„Dass Nichtstun der teuerste Zeitvertreib ist – ist nichts Neues. Aber reicht dir das? Kein Nervenkitzel mehr? Nie mehr in Schmuck für Hunderttausende wühlen? Nicht mehr tun und lassen können, was du willst? Kein Adrenalinstoß mehr? Und dazu eine Siebzehnjährige?“ Ich war skeptisch.
Rolf konterte. „Schau, wir sind beide nicht blöd, und trotzdem haben sie uns immer wieder am Arsch. Fast fünf Jahre habe ich im Knast verbracht. Das ist doch nicht das Gelbe vom Ei. In drei Monaten wird Marina achtzehn. Das klingt doch schon ganz anders.“
„Ich weiß nicht“, zweifelte ich, ohne auf Marina einzugehen. „Aussteigen ohne Kohle?“
„Um das zu ändern, sind wir ja hier. Übrigens, zur Warnung: sollte was schief gehen – diesmal schieße ich mir den Weg frei.“ Er klopfte auf seine Brusttasche, wo die Pistole steckte.
Ich nickte wortlos, die Zeiten wurden härter.
„Es tut sich was.“
Vor Langweile war ich eingenickt, zuckte hoch.
Tatsächlich, die Lichter im ersten Stock gingen aus, im Parterre ebenfalls, zwei Autos fuhren aus der Garage, und die Garagentür schloss automatisch.
Rolf nahm das Handy und rief an. Fünfmal klingelte es, dann meldete sich der Anrufbeantworter.
„Jetzt oder nie!“
Seit es Menschen gibt, die mehr besitzen als andere, existieren auch Diebe und Einbrecher. Die Besitzenden versuchen, das zu schützen, was ihnen gehört, vergittern ihre Fenster und Türen, bringen Schließen und Riegel an. Doch die Habenichtse ziehen immer wieder nach. Mit Intelligenz oder mit schierer Gewalt. So gut kann kein Schloss sein, dass es sich nicht knacken lässt, so dick kein Gitter, um einem Bolzenschneider zu widerstehen.
Nachdem die Besitzenden sich mehr und mehr armiert hatten, in einem Gefängnis lebten, die Außenwelt nur noch vergittert sahen und trotzdem nicht verschont geblieben sind, setzten sie auf eine neue Philosophie. Nicht das Eindringen ins Haus hieß es, unbedingt zu verhindern, sondern den unerwünschten Aufenthalt darin. Also installierte man die Alarmanlagen innen.
Der Sinn einer Alarmanlage besteht darin, dass sie Alarm schlägt. Aber nur dann, wenn der Hausherr oder die Hausfrau das möchte. Man macht sich die Technik zunutze. Einen Kontakt am Tür- oder am Fensterrahmen, einen an der Tür und am Fensterflügel. Berühren sich die Kontakte, fließt Strom durch, und alles ist in Butter. Wird ein Fenster oder eine Tür geöffnet, trennen sich die Kontakte, der Stromfluss wird unterbrochen und der Alarm ausgelöst. Solche Anlagen werden mit einem Schlüssel oder einem Code scharfgemacht und wieder stillgelegt. Findet man dieses Schloss, ist die Anlage keinen Pfifferling wert, Experten legen einfach die Elektrik lahm.
Aus Erfahrung klug geworden, lässt man die Verdrahtung nun weg und steuert die Anlage über Funk.
Das ist der Stand der Dinge. Ganz vorsichtige Hausherren kümmern sich nicht nur um Fenster oder Türen, sondern installieren zusätzlich noch Bewegungsmelder. Bewegt sich im Raum etwas, spricht der Sensor darauf an. Er kann Licht einschalten, Sirenen auslösen, automatisch die Polizei verständigen und so ziemlich alles, was ein sicherheitsbewusstes Hirn sich ausdenkt.
Alle Anlagen besitzen jedoch einen Knackpunkt: Sie müssen eine Möglichkeit haben, aktiviert und wieder ausgeschaltet zu werden. Von Hand oder mit Fernbedienung.
Eine der Personen hatte beim Verlassen eine Fernbedienung gedrückt.
Rolf nahm einen Kasten, nicht größer als ein Kofferradio.
„Die Alarmanlage im Haus ist jetzt scharf. Ich habe die Frequenz gescannt. Aber mein Sender ist viel, viel stärker. Ich decke jetzt die Frequenzen einfach ab. Die Anlage wird eingelullt.“
„Und das funktioniert?“ Technik war nicht mein Fachgebiet.
„Im Prinzip ja. Der ganze Ostblock hat früher mit dieser Methode die Westsender gestört. Aber das ist noch nicht alles.“ Er zeigte auf eine ganz normale Fernbedienung, wie sie zum Öffnen und Schließen einer Garage benutzt wird. „Der Sender für die Alarmanlage arbeitet auf 433,92 Megahertz. Meine Fernbedienungen für die Garage auch. Ich habe auf dieser Fernbedienung drei Knöpfe. Auf, zu und stopp. Jetzt überlege mal: Alle sind fort, die Anlage ist scharf. Ich habe gesehen, wie einer mit der Fernbedienung das Garagentor geschlossen hat. Was tun sie, wenn sie heimkommen? Sie öffnen mit der Fernbedienung die Garage. Und ich wette, damit wird auch die Alarmanlage entschärft.“
Ich hörte genau zu. „Was gibt es sonst noch für Stolpersteine?“
„Nun, es kann natürlich sein, dass wir nur bis in die Garage kommen, weil der misstrauische Hausherr überraschungen liebt, zur drahtlosen Anlage auch noch mechanische Melder installiert hat. Das erlebt man häufig bei Kellertüren, Waschküchen, Abstellräumen. Damit Insekten, Mäuse und Ratten nicht ungewollt Alarm auslösen. Es kann eine ganze Menge geben, was uns überraschen kann. Deshalb tust du ab jetzt haargenau das, was ich dir sage. Wie schnell kannst du laufen?“
Ich streichelte meinen glatten Bauch. „Zwölf Komma null auf hundert Meter. Mit Sirene im Rücken: Eins Komma null.“
Rolf schulterte den Matchsack, ich einen Rucksack. Da wir nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen wollten, hatten wir für alle denkbaren Eventualitäten vorgesorgt.
Rolf drückte einen Knopf. Tatsächlich öffnete sich die Garagentür.
Wie Soldaten robbten wir über die Wiese, auf das Haus zu. Trotzdem konnten wir den Scheinwerfern nicht ausweichen. Sollte wirklich noch jemand im Haus sein, würde er uns garantiert sehen.
Rolf bewegte sich wie eine Maschine, immer zwei Meter vor mir, meine Zunge schleifte schon nach halber Strecke über das Gras. Schließlich erreichten wir die Hauswand, standen im Lichtschatten.
Ich wollte ächzend fluchen, doch Rolf hielt den Finger vor den Mund. Wortlos schlichen wir am Haus entlang, einen Einstieg suchend. Auf der einen Seite stießen wir auf eine riesige Terrassentür, auf der anderen Seite auf zwei massive Haustüren. Wir huschten in die Garage, spähten umher. An der Wand hing ein kleiner Kasten mit Lämpchen und schwach blinkendem Rotlicht.
Ich deutete darauf. „Ist das die Schaltzentrale?“
Rolf zog die Nase hoch. Er traute dem Frieden nicht, der Kasten erschien ihm zu primitiv. Wie ein aufgescheuchter Fuchs kundschaftete er nach allen Seiten, verließ die Garage. Dann entdeckte er eine Treppe abwärts. Wir schlichen hinunter.
„Jetzt“, murmelte er, „tun wir so, als sei alles mehrfach gesichert!“ Er zeigte auf die Blechtür. „In diese Tür schneiden wir ein Loch. Groß genug, um hindurch zu schlüpfen. Gib mir die Bohrmaschine.“
Die batteriebetriebene Bohrmaschine surrte leise, als Rolf mehrere Löcher dicht nebeneinander in die Tür bohrte. So viele, bis er eine Blechschere mit großer Übersetzung einführen konnte. Verblüffend schnell schnitt er ein Rechteck aus, groß genug für uns, um durchzukriechen. Als wir in der Waschküche standen, untersuchte Rolf den Türstock.
„Da!“, konstatierte er grimmig und zeigte auf zwei graue Plättchen. „Reed-Kontakte! Arbeiten mit magnetischen Feldern. Ein Schubs an der Tür, und die Musik geht los. Wenn oben noch so eine Tür ist, dann gehe ich nach Hause.“
Die obere Tür bestand aus Eiche und stand offen.
Als Erstes entdeckte ich die Schaltzentrale der Alarmanlage. Beruhigend blinkte ein grünes Licht.
„Raffinierter Hund!“, murmelte Rolf, „das in der Garage ist ein Panikschalter. Hat nur einen einzigen Zweck: Sobald du daran fummelst, geht der Alarm los. Aber Halleluja, schau dir das an!“
Die Einrichtung stellte alles in den Schatten, was wir jemals gesehen hatten. Mahagoni und Teakholz dominierten den Raum, das einzige Gemauerte war der Kamin. Das Wohnzimmer war so groß wie ein komplettes Einfamilienhaus, im Jagdzimmer hingen ein präparierter Löwenkopf, ein Büffelkopf, ein Bärenkopf, hinter einer stählernen Gittertür lagerten Gewehre, in den Schubladen darunter die Okulare dazu. Der halbe Keller war als Weinkeller ausgebaut, bestückt mit allem, was gut und teuer war, klimatisiert, temperiert. Zwei Kühlhäuser, ein Gefrierhaus. Die zwei Gästezimmer barock, in jedem Bad ein Hot-Whirlpool aus rosa Marmor, das Schlafzimmer aus Tausend und eine Nacht, Baldachin, Teppiche, Bilder, Kleiderschränke zum Durchsteigen ins andere Zimmer. Nur das Arbeitszimmer elegant sachlich, funktionell.
Rolf fackelte nicht lange und zeigte auf die Glaslinsen in jeder Ecke. „Den elektronischen Zauber haben wir ausgetrickst. Bin ich nicht gut? Also los, lass den ganzen Quatsch liegen! Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, es kann sein, dass es zu allem Überfluss noch Gemeinheiten gibt, an die wir gar nicht denken. Also alle Konzentration auf die Suche nach einem Safe!“
Wir suchten ihn dort, wo wir ihn vermuteten und ihn auch fanden: im Arbeitszimmer. Aber wir fanden nicht einen Safe, sondern gleich zwei.
Gar nicht groß kaschiert standen sie nebeneinander in Augenhöhe hinter der Tür. Möbeltresore, eigentlich mehr als Schutz gegen Feuer und Explosion gedacht, mit Halteschrauben an der Holzwand befestigt. Ein Tresor mit Zahlenkombinationsschloss und Schlüsselloch, der andere mit drei Zahlenkombinationsschlössern bestückt.
„Himmel, Arsch und alles dazu!“, fluchte Rolf. „Was soll ich mit zwei Safes? Was ist in welchem?“
„Weiß ich doch nicht! Entscheide dich für einen! Sollte die Zeit tatsächlich reichen, können wir den zweiten immer noch holen.“
„Welchen?“
„Den besseren.“
„Kriegst du ihn auf?“
„Nein, du.“
„Wieso immer ich?“ Er packte sein Werkzeug aus. „Auf deine Verantwortung.“
„Quatsch nicht, fang an!“
Rolf murmelte noch etliche Verwünschungen und machte sich an die Arbeit. Da ich dabei nichts helfen konnte, machte ich mich auf die Suche nach Geld, Schmuck und allem, was wertvoll, einsteckbar und verkäuflich erschien. Geld fand ich in der Schreibtischschublade, im Nachtkästchen, in der Küche. Zwei Fünfhunderter, einige Hunderter und Zehner. Den Schmuck ließ ich liegen, es war Modeschmuck, nicht wert, ihn mitzunehmen. Die guten Stücke lagen wohl im Safe. Aber in welchem? Ich sah ein paar schöne Damenuhren, Manschettenknöpfe, überlegte, ignorierte. Sicherheit zuerst!
Aus dem Funkgerät krachte es, Rolf war bei der Arbeit, und bei mir fingen die Magenschmerzen an. Ich organisierte eine Plane, mit der wahrscheinlich erlegtes Wild transportiert wurde, und brachte sie zu Rolf.
Es war ein massiver Möbeltresor, vierzig mal vierzig Zentimeter. Da es keine gemauerten Ziegel gab, sondern nur Holzwände, mit denen der Tresor irgendwo mit Schrauben verbunden und befestigt war, brach Rolf das Holz einfach weg. Er schwitzte, atmete heftig. Immer wieder knallte ein Stück Holz davon. Zwei Seiten hatte er bereits freigelegt.
Geduckt schlich ich von einem Fenster zum anderen, in der Außenbeleuchtung erkannte ich jede Mücke. Himmel, wie sollten wir hier je ungesehen wegkommen?
Wieder ein Knall, wieder fielen Brocken zu Boden, auf den Teppich.
„Gleich gehört der Bursche mir“, murmelte Rolf, „ein echter Knüller! Schätze, um die siebzig Kilo. Gib mir die Vakuumsauger. Hast du was zum Einwickeln?“
Eigentlich gedacht, um Glasscheiben zu transportieren, eignen sich Vakuumsauger auch, um kleine, aber schwere Lasten zu tragen.
Ich drängte zur Eile, wurde nervös. Irgendetwas stimmte hier nicht, ich ahnte es mit jeder Faser und wusste nicht, was es war. Das machte mich hektisch und hilflos zugleich.
Als Rolf mit der letzten Seite fertig war und den Safe aus dem Loch zog und ich dabei half, entdeckten wir gleichzeitig die Überraschung. Doch es war schon zu spät. Ein hauchdünnes Elektrokabel war am Safe befestigt und riss. Im gleichen Moment schrillte ohrenbetäubender Lärm, die Außenlichter fingen an, heftig zu blinken, und am Hausdach rotierte eine rote Lampe.
Ich beugte mich vor und presste die Hand auf den Magen. Mir war schlecht, mein Blutdruck sackte in den Keller. Rolf schüttelte mich energisch. „Los, zehn Minuten dauert es mindestens, bis die Streife hier ist. Mach schon!“, schrie er mich an, weil ich immer noch nicht reagierte und drückte mir den Matchsack in die Hand.
„Alles einsammeln! Ich nehme den Safe, du suchst das Werkzeug zusammen. Lass ja nichts zurück!“
Wie in Trance gehorchte ich. Stück für Stück packte ich ein, ohne Überlegung, rein mechanisch. Rolf schulterte die Plane mit dem Safe und wäre beinahe gestolpert, so schwer wog der Kasten. Er riss ein Fenster auf und wuchtete den Safe hinaus, warf ihn auf die Wiese. Wir nahmen die nächste Terrassentür, hasteten aus dem Haus, suchten den Safe, rannten und schleppten ihn über den hell erleuchteten Rasen, die irre Sirene im Genick, erkannten schon das Loch im Zaun, als Schüsse fielen und zwei Kugeln über uns hinweg zirpten.
„Das gibt es nicht!“, kreischte ich voller Entsetzen und legte noch einen Zahn zu, das rettende Loch im Blickfeld.
Wieder fielen Schüsse, noch näher.
Rolf war am Zaun, schob den Safe durch, wollte sich selbst durchzwängen, schrie plötzlich unterdrückt auf und fiel um.
Ich lag neben ihm, verblüfft und verstört, bis zu den Ohren voll mit ohnmächtigem Zorn.
„Der Kerl hat mich getroffen“, stöhnte Rolf und zeigte auf sein Knie. Ein Zentimeter darüber klaffte ein Loch in der Hose, das sich schwärzlich-rot verfärbte. „Der Kerl hat mich getroffen.“ Er war grenzenlos verblüfft.
Weitere Schüsse krachten.
Ich schaute mich um.
Am Haus huschte ein Schatten hin und her. Es erinnerte mich an einen Scherenschnitt. Die Figur eines Männchens mit einem Gewehr tanzte herum wie Rumpelstilzchen, an die Hauswand riesig vergrößert geworfen, die lockigen, abstehenden Haare gut erkennbar. Das Männchen brüllte gegen die Sirene an, hob das Gewehr und schoss wieder.
Das war zu viel für meine Nerven. Ich, der nie etwas von Waffen wissen wollte, riss die Mauser aus Rolfs Jacke, lud durch und leerte das gesamte Magazin.
Das Männchen blieb ruckartig stehen, für einige Sekunden verharrte es stocksteif, dann ließ es das Gewehr fallen und rannte unkontrolliert im Kreis.
Rolf versuchte, mühsam aufzustehen. Das rechte Bein war taub, als gehörte es ihm nicht, als wäre es gar nicht da.
Ich musste ihn stützen.
Das Auto parkte hundert Meter weiter weg. Der Schweiß zog Striemen über unsere Gesichter.
Rolf ließ sich auf den Rücksitz fallen, ich warf die Tür zu, wollte ans Steuer.
„Zurück!“ keifte Rolf. „Hol den Safe!“
„Du bist übergeschnappt! In Sekunden wimmelt es hier von Polizei.“
„Hol den Safe! Sonst hol ich ihn, und wenn ich kriechen muss.“
„Oh nein, oh nein, oh nein! Willst du unbedingt in den Knast?“ Ich war schon unterwegs, zum Zaun, packte die Plane, flog hin, fluchte unentwegt, schleifte ihn einfach durch das Gras. Als ich am Auto anlangte und den Safe in den Kofferraum gewuchtet hatte, hörte ich das laute Tatütata.
(Auszug aus dem Roman von Peter Lohmann, Staniz bei Straden – Austria)
Alle Rechte der Texte verbleiben ausschließlich bei den Autoren. Eine Verbreitung, auch auszugsweise, ist – egal, in welcher Form – nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt.
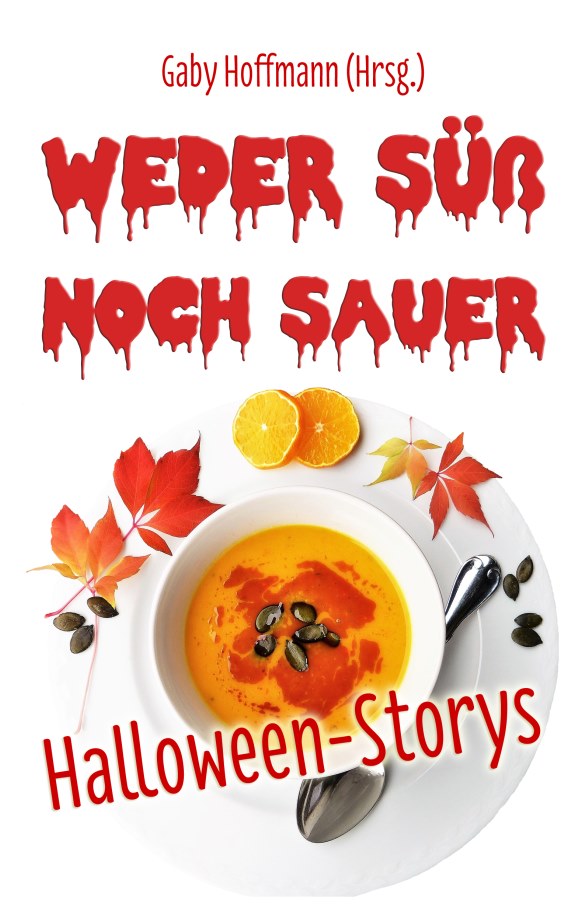 Nachdem uns einige Nachfragen erreichten, ob es denn neben dem E-Book auch eine Druckausgabe geben würde, mussten wir reagieren. Nun ist der Nachschlag da, rechtzeitig für den Nikolausstiefel und andere Gelegenheiten, wo man ein Mitbringsel braucht: Das Taschenbuch zu unserer Halloween-Anthologie »Weder süß noch sauer« ist bei Amazon (Partnerlink zu Amazon) erschienen!
Nachdem uns einige Nachfragen erreichten, ob es denn neben dem E-Book auch eine Druckausgabe geben würde, mussten wir reagieren. Nun ist der Nachschlag da, rechtzeitig für den Nikolausstiefel und andere Gelegenheiten, wo man ein Mitbringsel braucht: Das Taschenbuch zu unserer Halloween-Anthologie »Weder süß noch sauer« ist bei Amazon (Partnerlink zu Amazon) erschienen!